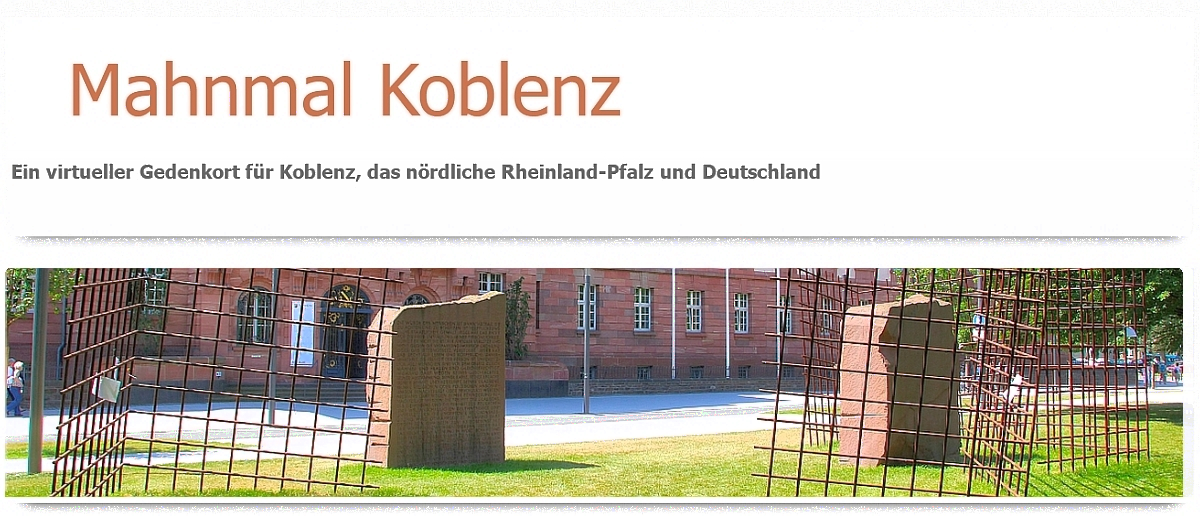Vom KZ-Häftling zum Regierungsvizepräsident: Vortrag zu Alfred Knieper in der SGD Nord
Mehrfach in „Schutzhaft“, deportiert in die Konzentrationslager Esterwegen und Buchenwald – und später Regierungsvizepräsident in Rheinland-Pfalz: Das Leben von Alfred Knieper war erschütternd und eindrucksvoll zugleich. Um die Erinnerung an den in Zell geborenen Gewerkschafter und die Grausamkeit des Nationalsozialismus wachzuhalten, lädt der Förderverein Mahnmal Koblenz am Dienstag, 20. Mai 2025 zu einem Vortrag in der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ein. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos.
Alfred Knieper war Keramikarbeiter, Gewerkschafter, Kommunist, KZ-Häftling, Regierungsvizepräsident und vieles mehr. Er erlebte unter der NS-Herrschaft Verfolgung und mehrere Inhaftierungen. Nach seiner Befreiung 1945 blieb er politisch aktiv und wurde 1946 zum Regierungsvizepräsidenten des neu gebildeten Regierungsbezirks Montabaur ernannt.

Alfred Knieper
Der Vortrag in der SGD Nord schildert anhand vieler historischer Fotos und Dokumente die sehr vielschichtige Lebens- und Leidensgeschichte von Alfred Knieper, der stellvertretend für all jene Menschen steht, die in der Zeit des Nationalsozialismus aufgrund ihrer Überzeugungen verfolgt wurden.
Die Veranstaltung findet am Dienstag 20. Mai 2025 ab 17 Uhr im Großen Sitzungssaal der SGD Nord statt. Er ist Teil der Veranstaltungsreihe „Koblenz erinnert: 80 Jahre Kriegsende und Befreiung“ der Stadt Koblenz. Die SGD Nord ist Mitglied und Kooperationspartner des Fördervereins Mahnmal Koblenz.

Presseerklärung des Fördervereins Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V.:
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Koblenz erinnert: 80 Jahre: Kriegsende und Befreiung“ präsentiert der Förderverein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. eine kleine Ausstellung zur Erinnerung an den Metternicher Johann Dötsch (1890 – 1946), Dötsch war zurzeit der Weimarer Republik Unterbezirksvorsitzender der SPD und Mitglied des Provinziallandtages. Deswegen war er wiederholt kürzere Zeit hier in Koblenz in „Schutzhaft“ und dann mit Kriegsbeginn ab 1. September 1939 Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin. Am 21. April 1945 musste er von dort mit 33.000 Mit-Häftlingen auf den „Todesmarsch“ Richtung Norden, Anfang Mai kam er frei. Über den Marsch und die erste Zeit danach schrieb er ein „Tagebuch gegen das Vergessen“.
Dieses wichtige Zeitdokument ist in Kopie jetzt mit einer Biografie von Johann Dötsch am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Reichensperger Platz ausgestellt und nachzulesen. Lesen Sie hier zwei Auszüge:
9. Mai 1945. Das Leben geht weiter. (…) Zum ersten Mal nach fast sechs Jahren an einem sauberen Tisch mit netten, lieben Menschen zusammen bei einer Tasse Tee und einer Zigarette. Nach den Jahren des Grauenvollen in den Mörderhänden der SS in überfüllten Baracken mit oft sehr zweifelhaftem Gesindel. Die letzten vier Monate dauernd unter Hunger leidend. Es gab täglich nur einen Liter Steckrübenwassersuppe und 200 Gramm Brot, bei 11stündiger Arbeitszeit und vorher einer Stunde Appell. Und doch kommt jetzt keine himmelstürmende Freude auf. Der Körper ist zu abgehetzt und zum Skelett abgemagert. Ich hoffe sehr, dass mit zunehmender körperlicher Erstarkung auch die Lebensgeister wieder erstarken. Vorläufig heißt es abwarten. Wenn nur erst die Post ginge, damit man endlich Nachricht geben könnte.
….
16. Mai 1945. Abends gabs die erste Zeitung. Endlich einmal eine klare Nachricht über das weltgeschichtliche Geschehen. Nie haben wir gieriger nach einer Zeitung gegriffen. Wie man immer erwartet hat, ist die ganze Bande im letzten Augenblick ausgerückt oder hat Selbstmord begangen. Doch die Allermeisten werden ihrer verdienten Strafe nicht entgehen. Oft frage ich mich, warum wir selbst nicht an unseren Peinigern Rache genommen haben, als ihre Macht vorbei war an jenem für uns so denkwürdigen Abend des 2. Mai. Der Grund lag wohl darin, dass wir physisch viel zu erschöpft waren, um Vergeltung zu üben, doch ich bin sicher, die Vergeltung für ihre furchtbaren Verbrechen wird auch den letzten Schuldigen zu finden wissen. (…) Nie finde ich einen Flüchtling mit reifen politischen Gedanken, nie einen, der auch nur mit einem Gedanken an die grässlichen Untaten der SS in Polen, der Ukraine und in allen besetzten Teilen Europas denkt. Niemand denkt an die Millionen Menschen aus allen Ländern Europas, die von den Nazis als Sklaven nach Deutschland getrieben wurden und dort unter unwürdigsten Bedingungen zur Arbeit gepresst wurden. Niemand denkt an die hunderttausende Kinder von 13 und 14 Jahren, die ebenso wie Erwachsene nach Deutschland verschleppt wurden. Wenn diese Kinder dann vom Heimweh getrieben ausrissen und planlos ostwärts irrten, wurden sie ergriffen und in die KZ gesteckt. Wir hatten über 500 von diesen Kindern im Lager. An all das denkt der deutsche Spießer nicht. Er hat nur Gefühl für seine eigene Not und eine panische Angst vor seiner Verschickung nach Sibirien. (…) Deshalb wollen die Allermeisten nicht in die von den Russen besetzten Gebiete zurück, alles will zu den Amerikanern. Wie das gehen soll und dass das unmöglich ist, bedenkt der Spießer nicht. Er glaubt, wenn er jetzt reichlich auf Hitler schimpft, vollauf seine Pflicht getan zu haben. Das deutsche Volk wird sich noch sehr wundern, die Strafe der Sieger wird diesmal fürchterlich sein und wir haben kein Recht, uns zu beklagen. Die Schuld des deutschen Volkes ist zu groß.
Erst Monate später konnte Johann Dötsch nach Koblenz zurückkehren. Hier war er Mitbegründer der SPD nach dem Krieg und Präsidialdirektor der kurzzeitig bestehenden Provinz Rheinland/Hessen-Nassau. Im Oktober 1946 starb er an den Folgen der erlittenen KZ-Haft.
80 Jahre später steht die Frage im Raum: Haben wir aus der Geschichte gelernt?


Das Mahnmal für die NS-Opfer auf dem Reichensperger Platz.